Ein allzu kurzes Leben. Interview mit Ronald Reng
Ronald Reng: Ich wusste vor seinem Tod nichts von Roberts Depressionen, dementsprechend unvorbereitet traf mich die Nachricht, er habe sich selbst getötet. Zumal ich an jenem 10. November 2009 in den Abendstunden seinen Rückruf erwartete.
Am 10. November 2009, vor genau sechs Jahren, hat sich der Nationaltorhüter Robert Enke das Leben genommen. Sie sind seit fast 20 Jahren Sportjournalist und haben sich mit Robert Enkes Biografie intensiv befasst. Was haben Sie empfunden, als Sie von seinem Freitod erfahren haben?
Ich wusste vor seinem Tod nichts von Roberts Depressionen,  dementsprechend unvorbereitet traf mich die Nachricht, er habe sich selbst getötet. Zumal ich an jenem 10. November 2009 in den Abendstunden seinen Rückruf erwartete. Wir hatten am Mittag kurz telefoniert, er sagte, er habe keine Zeit und würde sich am Abend melden. Als er nicht mehr anrief, verstand ich, warum er mittags keine Zeit gehabt hatte: Er hatte sein Ableben vorbereitet.
dementsprechend unvorbereitet traf mich die Nachricht, er habe sich selbst getötet. Zumal ich an jenem 10. November 2009 in den Abendstunden seinen Rückruf erwartete. Wir hatten am Mittag kurz telefoniert, er sagte, er habe keine Zeit und würde sich am Abend melden. Als er nicht mehr anrief, verstand ich, warum er mittags keine Zeit gehabt hatte: Er hatte sein Ableben vorbereitet.
Glauben Sie, dass Herr Enke ein Sonderfall war oder geht es vielen Sportlern wie ihm? Welches Gewicht haben der ständige Leistungsdruck und die Beobachtung durch die Medien wie natürlich auch die mitunter unfaire Bewertung durch Fans?
Wissenschaftler gehen davon aus, dass jeder zehnte Deutsche in seinem Leben ein- oder mehrmals eine Depression durchlebt. Es gibt keinen Grund zu glauben, dass im Profifußball weniger Menschen von psychischen Krankheiten betroffen sind, als im Landesschnitt. Der Leistungsdruck kann ein Auslöser für Depressionen sein, aber es wäre falsch, den Eindruck zu erwecken, als seien Hochleistungssportler deshalb besonders depressionsgefährdet. Eine Sekretärin oder ein Schornsteinfeger, die eine Anfälligkeit für Depressionen haben, erleben ähnlich viele Stressmomente, die die Krankheit auslösen können. Denn das Stressempfinden ist immer subjektiv.
Wie betroffen war das soziale Umfeld nicht nur von der Tat, sondern auch von den öffentlichen Reaktionen darauf? Gab es neben Erschütterung und Verzweiflung auch Menschen, vielleicht Sportkollegen, die mitunter selbst mit ähnlichen Gedanken kämpfen?
Die öffentliche Reaktion war in ihrer Breite von großem, fast übersteigertem Mitgefühl geprägt. Ich glaube, das hat indirekt Roberts Familie kurzfristig erst einmal geholfen: Das Gefühl, nicht alleine dazustehen.
Sie sind bei Ihrer Beschäftigung mit Robert Enke nicht nur auf die privaten und gesundheitlichen Gründe und Bedingungen für Suizid gestoßen, sondern konnten ebenso feststellen, wie Medien mit diesem Thema umgehen. Sind Sie der Meinung, dass Medien adäquat mit ihm als Menschen und seiner Entscheidung, aus dem Leben zu gehen, umgegangen sind?
Im Großen und Ganzen war die Berichterstattung über Roberts Tod sehr kompetent. In vielen Zeitungen – ich erinnere mich zum Beispiel an einen Artikel in der Frankfurter Rundschau – wurden Depressionen sehr detailliert und sehr fundiert erklärt. Dass viele Journalisten kleine Fehler begingen (etwa zu beschreiben, auf welche Art sich Robert tötete, was vermieden werden soll, um keine Nachahmer zu wecken), gehört dazu: Es war für die meisten Neuland, über eine Selbsttötung berichten zu müssen.
Wissen Sie, ob die Ereignisse um Robert Enke Konsequenzen für die Arbeit mit und Betreuung von Spielern in Vereinen oder beim DFB hatten? Gibt es auf der Ebene der FIFA konkrete Beratungs- oder Hilfsprogramme?
Nach Roberts Tod wurde auf allen möglichen Ebenen des Profifußballs beraten, was die Vereine und Verbände tun müssen, um psychische Krankheiten unter den Hochleistungsspielern besser zu behandeln. Einiges ist seitdem passiert, so hat die Enke-Stiftung etwa ein Netzwerk von Sportpsychiatern und Psychotherapeuten aufgebaut, die erkrankten Sportlern sofort zur Verfügung stehen. Andererseits tun viele Vereine noch immer ihre Verantwortung damit ab, sie hätten doch einen Sportpsychologen. Dass der in der Regel nur die mentale Leistungsfähigkeit zu steigern versucht und gar nicht die Fähigkeit besitzt, einen psychisch Überlasteten zu betreuen, wird übersehen.
In der Öffentlichkeit wird immer wieder diskutiert, ob Suizide in den Medien thematisiert werden sollen. Unvergessen sind die auffällig deutlich gestiegenen Fälle jugendlicher Schienensuizide nach den Ausstrahlungen der ZDF-Serie „Tod eines Schülers“ 1981 und 1982. Das ZDF gab sogar zwei Gutachten in Auftrag, um sich von einer Verantwortung zu befreien. Welchen Rat würden Sie Nachwuchsjournalisten oder auch Sozialarbeitern mit Einfluss auf andere Menschen geben, die sich mit diesem Thema befassen möchten oder müssen?
Die Berichterstattung über Suizide sind ein Balanceakt. Einerseits kommt es bei detaillierter Berichterstattung zu Nachahmern, das war leider auch bei Robert Enke der Fall. Andererseits ist es für die Aufklärung über Depressionen unabdingbar, dass auch über Selbstmordgedanken und Selbstmorde berichtet wird. Denn diese sind leider Teil der Krankheit. Es ist eben kein „Freitod“, wenn ein depressiver Mensch sich tötet; frei ist an der Entscheidung nichts. Die Krankheit hat die Zusammensetzung seines Gehirns verändert, er ist nicht mehr in der Lage, seine Verzweiflung rational zu kontrollieren und glaubt fatalerweise, sich umzubringen hieße, seine Krankheit endlich loszuwerden.
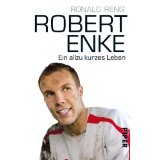
Ronald Reng ist Sportjournalist und Buchautor. Er schreibt unter anderem für die taz und die Süddeutsche Zeitung über Fußball, aber auch über Randsportarten wie Frauenhockey.
Im Jahr 2010 schrieb er in Zusammenarbeit mit Teresa Enke die Robert-Enke-Biografie „Robert Enke. Ein allzu kurzes Leben“. Im November 2011 wurde ihm für seine Biographie über Robert Enke die Auszeichnung William Hill Sports Book of the Year, verliehen. Die Enke-Biographie wurde in Großbritannien auch zum Football Book of the Year 2012 gekürt und ist in viele Sprachen übersetzt worden.
Zur Facebookseite von Ronald Reng
(Das Interview führte Stefan Piasecki)
